
Start / Energielösungen / Heizen mit Gas / Kraft-Wärme-Kopplung
Blockheizkraftwerke sind für viele Gewerbebetriebe eine gute Lösung für die Energieversorgung. Die gleichzeitige Erzeugung von Wärme und Strom – die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung – ist effizient und kostensparend.
Blockheizkraftwerke (BHKW) arbeiten nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung und werden schon seit Jahren zur dezentralen Erzeugung von Wärme und Strom eingesetzt – gerade in Gewerbe und Industrie. Für die verschiedenen Anwendungsbereiche werden BHKW-Anlagen in einem weiten Leistungsbereich angeboten, bis hin zu mehreren Megawatt Leistung.
Als Mini-BHKW werden Blockheizkraftwerke bezeichnet, die maximal 50 kW elektrische Leistung aufbringen. Diese Anlagen sind sehr kompakt gebaut, in der Regel direkt anschlussbereit und besonders für kleine bis mittlere Gewerbeeinheiten geeignet. Auch Anlagen größerer Leistung sind als sogenannte Containerlösungen anschlussfertig verfügbar.
BHKW können schon in kleinen Gewerbeeinheiten erheblich zur Senkung der Energiekosten beitragen. Sinnvoll ist die Investition in ein BHKW aber auch in größeren Fertigungsbetrieben mit einem konstant hohen Energiebedarf. Mit dem Einsatz eines dezentralen BHKW lassen sich gegenüber einer herkömmlichen Gas-Niedertemperaturheizung bis zu 36 Prozent der Energiekosten einsparen.
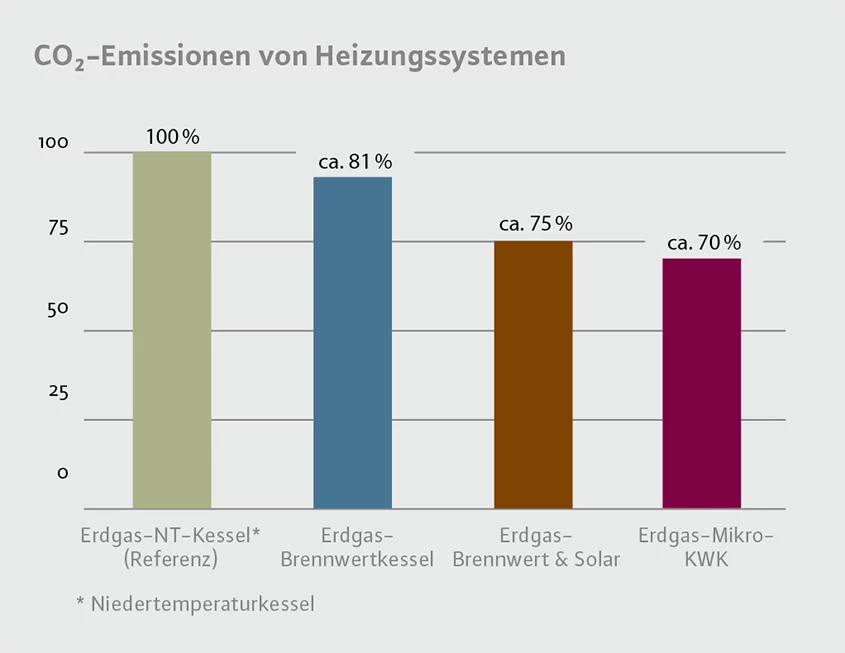
Im Verbund mit einem oder mehreren Heizkesseln sollte ein BHKW die Grundlast der Wärmeerzeugung abdecken oder mindestens 4.000 Betriebsstunden im Jahr erreichen. Besonders wirtschaftlich arbeiten BHKW dann, wenn sie mit 4.500 oder mehr Betriebsstunden im Jahr gefahren werden. Bedarfsspitzen decken modular zuschaltbare konventionelle Heizgeräte ab, zum Beispiel klassische Gas-Brennwertkessel.
BHKWs sind für viele Branchen eine attraktive Lösung für die Energieversorgung, denn die gleichzeitige Erzeugung von Wärme und Strom ist ökologischer und effizienter als die getrennte Erzeugung. Der Berater Ihres Energieversorgers unterstützt Sie bei der Planung und Dimensionierung einer solchen Anlage.
Die Installation einer BHKW-Anlage ist in der Regel innerhalb weniger Tage abgeschlossen, und damit kann Energie aus der Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden. Dank der ausgereiften Technik läuft der Betrieb problemlos, der Wartungsaufwand ist entsprechend gering.
Zur möglichst optimalen Nutzung der von ihnen erzeugten Wärmeenergie werden BHKW oft in bestehende Heizsysteme integriert. Deshalb sollte bereits in der Planungsphase die technische Kompatibilität von Heizungssystem und BHKW systematisch gesichert werden: Das gilt vor allem für die hydraulischen Verhältnisse in Wärmeverteilungssystemen, für das Mess- und Regelsystem sowie für den Stromanschluss. Neben dem eigentlichen BHKW-Modul enthalten die Systeme oft auch Warmwasser- und Wärmespeicher.
Nano-BHKW
Elektrische Leistung: < 1 kW
Einsatz: Ein- und Zweifamilienhäuser
Mikro-BHKW
Elektrische Leistung: 1–2 kW
Einsatz: Ein- und Zweifamilienhäuser
Mini-BHKW
Elektrische Leistung: 2–20 kW
Einsatz: Ein- und Mehrfamilienhäuser, Gewerbe
Midi-BHKW
Elektrische Leistung: 20–50 kW
Einsatz: Mehrfamilienhäuser, Wohnblocks, Gewerbe
BHKW
Elektrische Leistung: 50 kW–1 MW
Einsatz: Wohnblocks, Gewerbe, Industrie, Verwaltungsgebäude
Groß-BHKW
Elektrische Leistung: 1–10 MW
Einsatz: Quartiere, Stadtviertel, Industrie
Ottomotoren kennt man als Antrieb für Autos oder Schiffe. In einem Blockheizkraftwerk treibt der Motor statt eines Fahrzeugs einen elektrischen Generator an. Die dabei anfallende Abwärme der Abgase (400 bis 600 °C), des Motors, Kühlwassers, der Schmiermittel (80 bis 90 °C) und die Generatorabwärme können über einen oder mehrere Wärmetauscher zu Heizzwecken genutzt werden. Derartige Anlagen benötigen eine Rücklauftemperatur der Heizung von unter 70 °C.
Zur Luftreinhaltung werden die Aggregate häufig mit einem Drei-Wege-Katalysator ausgestattet. Der vom Generator erzeugte Strom wird bevorzugt im eigenen Objekt verwendet und ersetzt somit den Strombezug aus der externen Versorgung. Somit kann sich ein Unternehmen mit einer KWK-Anlage auch ein Stück weit unabhängig von der Entwicklung der Strompreise machen. Eventuell anfallende Stromüberschüsse werden in das allgemeine Stromnetz eingespeist und von den Netzbetreibern zu den gesetzlich festgelegten Preisen vergütet.
Blockheizkraftwerke werden im Leistungsbereich zwischen 1 kWel bis 20.000 kWel angeboten. Die thermische Leistung ist in der Regel dreimal so hoch.
In großen Gaskraftwerken sind Gasturbinen für die Erzeugung elektrischer Energie zuständig, die dabei entstehende Wärme wird abgekoppelt und zum Beispiel in Nah- oder Fernwärmenetze eingespeist. In BHKW-Anlagen mit Gasturbinen wird dieses Prinzip ebenfalls angewendet, nur eben in kleinerem Maßstab. In der Turbine wird Luft verdichtet, in der Brennkammer mit Gas vermischt und dann gezündet. Das bei der Verbrennung entstehende Heißgas entspannt im nachfolgenden Turbinenteil, wodurch kinetische Energie freigesetzt und auf eine Welle übertragen wird.
Brennstoffzellen zählen ebenfalls zu den KWK-Technologien, auch wenn sie streng genommen nicht nach dem KWK-Prinzip arbeiten: Die innovativen Geräte erzeugen Strom auf direktem Weg durch einen elektrochemischen Prozess und nicht über den „Umweg“ der Erzeugung kinetischer Energie zur Stromproduktion wie in klassischen KWK-Anlagen.
Bei diesem Prozess entsteht Wärme, die zur Raumbeheizung, für die Trinkwassererwärmung oder auch als Prozesswärme genutzt werden kann. Brennstoffzellen für Einfamilienhäuser werden derzeit in den Markt eingeführt, sie kommen aber auch schon in Gewerbebetrieben zum Einsatz. Brennstoffzellen überzeugen durch ihre hohe Zuverlässigkeit und sehr günstige Verbrauchskosten.
Der Vorteil von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen liegt in ihrer besonders effizienten Betriebsweise. Während bei der konventionellen Stromerzeugung die anfallende Wärme zum Teil ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird, wird sie bei KWK-Anlagen nutzbar gemacht: als Heizwärme und in Gewerbebetrieben auch als Prozesswärme.
Blockheizkraftwerke erreichen einen Gesamtwirkungsgrad von über 90 Prozent. Die elektrischen Wirkungsgrade liegen bei Anlagen in der gewerblichen Nutzung bei etwa 40 Prozent; die thermischen Wirkungsgrade variieren zwischen etwa 60 Prozent bei den kleinen und ca. 45 Prozent bei den großen Motoren.
Statt Wärme und Strom können BHKW zum Beispiel auch Wärme und Druckluft erzeugen. Mit einem Kraft-Wärme-Kopplungs-Kompressor – kurz: KWK-Kompressor – geschieht das besonders effizient. Dieses Prinzip kommt vor allem für solche Betriebe infrage, die einen ganzjährigen Wärmebedarf haben und außerdem Druckluft für ihre Produktionsprozesse nutzen.
Dabei wird der Verbrennungsmotor des BHKW direkt an die Druckluftschraube gekoppelt. Die mit Gas produzierte Druckluft lässt sich sogar in einem geschlossenen Kreislauf recyclen und so noch effizienter nutzen. Mit der Kombination aus BHKW und KWK-Kompressor lassen sich bis zu zwei Drittel Primärenergie einsparen, entsprechend verringern sich Energiekosten und CO2-Ausstoß.
Falls im Betrieb kein ganzjähriger Wärmebedarf besteht, kann über die Kopplung des BHKW mit Adsorptionskältemaschinen auch Kälte produziert werden.
Unsere Übersicht Anmeldeverfahren und Betrieb Mikro-/Mini-KWK-Anlagen inkl. Brennstoffzellen listet die erforderlichen Anträge, Genehmigungen, Registrierungen, Meldungen und jährlich wiederkehrenden Vorgänge für KWK-Anlagen im kleinen Leistungsbereich bis 20 kW elektrisch auf.

Erfahren Sie mehr zu Kosten und Wirtschaftlichkeit und den Einsatzmöglichkeiten.

Übersicht Anmeldeverfahren und Betrieb Mikro-/ Mini-KWK-Anlagen inkl. Brennstoffzellen

Kosteneffizient im Gewerbe: Gasbetriebene Blockheizkraftwerke
Die Hauptkomponenten von KWK-Anlagen und Blockheizkraftwerken (BHKW) sind:
Darüber hinaus enthalten BHKW, egal ob Mini-Blockheizkraftwerke oder größere Anlagen, noch weitere Komponenten, zum Beispiel Steuerungs- und Regelungseinrichtungen, Katalysatoren zur Reduzierung der Schadstoffemissionen, Zu- und Ablufteinrichtungen oder Schallschutzeinrichtungen.
KWK-Anlagen werden unterschiedlich angetrieben. Neben Ottomotoren werden im Gewerbe hauptsächlich BHKW mit Gasturbinen eingesetzt.
Die Wirtschaftlichkeit von KWK-Anlagen wird zu einem Großteil von Förderprogrammen, gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen geprägt. Blockheizkraftwerke bzw. KWK-Anlagen werden durch unterschiedliche Fördermaßnahmen unterstützt. Die Bandbreite der Förderungen von KWK-Anlagen reicht dabei von Bundesgesetzen wie dem KWK-Gesetz über Programme der Bundesländer bis hin zu regionalen Förderprogrammen.
Eine zentrale Förderung der BHKW-Anlagen wird durch das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G) gewährt. Dieses Gesetz fördert KWK-Anlagen zeitlich befristet mit einem KWK-Zuschlag. Neben diesem Zuschlag kann auch die Infrastruktur von KWK-Anlagen – also Wärme- und Kältenetze sowie Wärme- und Kältespeicher – unter bestimmten Bedingungen finanziell gefördert werden.
Zum 1. Januar 2016 ist das neue KWK-G in Kraft getreten, das eine neue Staffelung für die Zuschläge auf den ins Netz eingespeisten Strom vorgibt. Detaillierte Informationen zu den neuen Förderbedingungen erhalten Sie zum Beispiel auf der Website der ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.
Als zweites Fördergesetz ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz zu nennen. Außerdem erhalten das Energiesteuer- und das Stromsteuergesetz einige Sonderregelungen, die für Betreiber von BHKW-Anlagen interessant sind. So erhalten BHKW-Anlagenbetreiber, deren Anlagen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, auf Antrag die Energiesteuer für den eingesetzten Brennstoff zurückerstattet. Betreiber von KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von unter 2.000 kW sind eventuell von der Stromsteuer befreit.
Auf Bundesebene existieren weitere Förderprogramme wie KfW-Förderprogramme, Marktanreizprogramme oder das Mini-KWK-Impulsprogramm, über das Zuschüsse für eine Mini-KWK-Anlage vermittelt werden. Seit April 2012 werden Mini-KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu 20 kWel unter bestimmten Voraussetzungen gefördert.
In vielen Bundesländer existieren zusätzliche Förderprogramme, auf deren Basis auch BHKW-Anlagen bezuschusst werden können. Diese Programme beginnen jeweils nach Freigabe der Haushaltsmittel und enden ggf. vor Jahresfrist, sofern mehr Fördergelder abgerufen werden als im jeweiligen Landeshaushalt eingestellt worden sind. Einen Überblick zu den aktuell geltenden Förderprogrammen und wertvolle Hinweise zur Beantragung von Förderungen erhalten Sie zum Beispiel auf der Website der febis Service GmbH.
Auch auf regionaler Ebene existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Fördermaßnahmen. Rund 350 regionale und überregionale Förderprogramme für BHKW-Anlagen können ggf. genutzt werden. Auskunft erteilt zum Beispiel eine örtliche Energieagentur. Zahlreiche Energieversorger bieten ebenfalls Förderprogramme oder Finanzierungshilfen für die Anschaffung und Installation einer KWK-Anlage an.
Falls Sie Fragen zu den verschiedenen Förderprogrammen haben, sollten Sie am besten den Fachberater Ihres Energieversorgers kontaktieren. Angesichts der komplexen Festlegungen zum Beispiel im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz empfiehlt sich für Gewerbetreibende der Austausch mit einem Energieexperten.
Krankenhäuser sind besonders geeignet für den Einsatz von Blockheizkraftwerken, da sie einen ganzjährig relativ gleichbleibenden und vor allem gleichzeitigen Bedarf an Strom und Wärme haben. Moderne Kraft-Wärme-Kopplung Anlagen (KWK-Anlagen) sind effizient und erzeugen nicht nur Wärme, sondern auch Strom. Dadurch lassen sich Energiekosten einsparen und CO2-Emissionen reduzieren. Wichtig für den wirtschaftlichen Betrieb eines BHKW mit Gas ist eine sorgfältige Planung und Dimensionierung der Anlage. Dies gelingt zum Beispiel in einem Contracting-Projekt mit einem Energieversorger.
Der Kostendruck im Gesundheitswesen betrifft auch die Krankenhäuser: Sie müssen sich zunehmend als wirtschaftlich arbeitende Unternehmen positionieren. Bei der Suche nach Einsparpotenzialen sind in vielen Krankenhäusern und Kliniken auch die Energiekosten in den Blickpunkt gerückt. In Deutschland gibt ein Krankenhaus pro Jahr durchschnittlich 500.000 Euro für Energie aus, das entspricht zwischen 2 und 3 Prozent der Gesamtkosten. Daran wird erkennbar, dass sich der Betrieb eines Krankenhauses sehr viel deutlicher auf die Kosten auswirkt als der Bau.
Krankenhäuser haben einen hohen und im Vergleich zu anderen Unternehmen spezifischen Energiebedarf, denn sie benötigen Strom und Wärme häufig zeitgleich und in großen Mengen. Das sind ideale Einsatzbedingungen für die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Zahlreiche Krankenhäuser haben in den letzten Jahren effiziente gasbetriebene Blockheizkraftwerke (BHKW) installieren lassen. Mit dieser Technologie können Krankenhäuser nicht nur ihre Wärmeversorgung sicherstellen, sondern auch den benötigten Strom selber erzeugen.
Im Vergleich zur getrennten Erzeugung von Strom (in Großkraftwerken) und Wärme verbraucht ein BHKW ca. 36 Prozent weniger Primärenergie. Der Wirkungsgrad liegt bei 87 Prozent und höher. Durch die effiziente Energienutzung schonen BHKW nicht nur Budget und Ressourcen, sondern über die Reduzierung der Emissionen auch das Klima.
Krankenhäuser benötigen aber nicht nur Wärme, sondern auch Kälte, zum Beispiel für die Klimatisierung von OP-Räumen. Zahlreiche Kliniken nutzen hierfür noch elektrische Kompressionskälteanlagen, die sich zum Beispiel mit einem BHKW kombinieren lassen und den erzeugten Strom nutzen. Auch die moderneren Absorptions- und Adsorptionskälteanlagen sind mit einem gasbetriebenen BHKW kombinierbar: Sie nutzen die erzeugte Wärme des BHKW. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Rubrik Kühlen und Klimatisieren. Eine genaue Bestandsaufnahme und eine bedarfsgerechte Planung und Auslegung der Anlage sind bei der Modernisierung der Wärmeversorgung inklusive Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung sehr wichtige erste Schritte. Energiekosten lassen sich unter anderem über die passende Dimensionierung der Anlagen reduzieren: Die Energieversorgung ist in vielen Krankenhäusern über die Jahre „mitgewachsen“ und folglich überdimensioniert, da zum Beispiel zwischenzeitlich Abteilungen wie Wäscherei oder Küche outgesourct worden sind.

Um die Energiekosten zu reduzieren, nutzt das Kreiskrankenhaus Freiberg die Quellwärme von Grubenwasser zum Betrieb einer Ammoniak-Wärmepumpe. Durch die effiziente Kombination mit einem gasbetriebenen BHKW deckt das Krankenhaus so rund 80 % seines Wärmebedarfs selbst ab.
Das Kreiskrankenhaus Freiberg wurde über einem alten Silberbergwerk erbaut. Das in 200 m Tiefe darunter fließende Grubenwasser weist ganzjährig konstant eine Temperatur von 14 °C auf. Um diese Quellwärme zu nutzen, wurde eine zweistufige Ammoniak-Wärmepumpe eingebaut, die zur weiteren Effizienzsteigerung mit einem gasbetriebenen Blockheizkraftwerk kombiniert wurde.
Die Ammoniak-Wärmepumpe erzeugt eine primäre Heizleistung von 860 kW. Ein Verdichter mit 215 kW Leistung hebt die dem Grubenwasser entnommene Wärme auf maximal 70 °C an. Das in das System eingebundene Gas-BHKW steigert den Gesamtwirkungsgrad der innovativen Anlage, denn sowohl die elektrische als auch die Wärmeenergie fließen in den Prozess ein: Der selbst erzeugte Strom wird zum Betrieb des Kompressors verwendet, die entstehende Abwärme wird dem Heizkreislauf zugeführt. So steigen die anfänglichen 70 °C auf 76 °C. Die Gesamtheizleistung erreicht durch die intelligente Kombination von gasbetriebenem BHKW und Ammoniak-Wärmepumpe rund 1.160 kW.
Für das Kreiskrankenhaus entsteht durch die Kombination Wärmepumpe und BHKW eine spürbare Entlastung bei den Betriebskosten. Insgesamt wird mit einer Einsparung von ca. € 350.000 gerechnet – das ist fast ein Drittel der durchschnittlichen Jahresenergiekosten. Die nachhaltige und kosteneffiziente Energieerzeugung ist für das Kreiskrankenhaus Freiberg ein wichtiger Schritt, um seine Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Zudem wird der CO2-Ausstoß deutlich reduziert – pro Jahr werden voraussichtlich 3.383 Tonnen CO2 eingespart.
© Ungekürzt veröffentlich in „Moderne Gebäudetechnik“ Heft 6/2017, Seiten 38 und 39; www.tga-praxis.de
Zahlreiche Krankenhäuser arbeiten in Contracting-Projekten eng mit Energieversorgern zusammen. Contracting bedeutet eine langfristig zuverlässige Versorgung bei sinkenden Energiekosten und führt oft zu einer personellen und damit finanziellen Entlastung. Außerdem ermöglicht Contracting die Umsetzung ganzheitlicher Energiekonzepte in einem Krankenhaus.
Beim Contracting übernimmt in der Regel ein Contractor das Betriebsrisiko der Energieanlage. Wenn ein Krankenhaus die Wärme-, Dampf- oder Stromerzeugung auf eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage umstellen möchte, erledigt der Contractor je nach Vertragsgestaltung die Finanzierung und trägt also für ein BHKW die Kosten. Sorgfältig geplante und bedarfsgerechte Contracting-Lösungen bringen Planungssicherheit, Entlastung auf der wirtschaftlichen Seiten genauso wie in der täglichen Arbeitspraxis.
Auch wenn eine Detailplanung unerlässlich für den wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb eines BHKW ist, können Sie sich dennoch über die Kosten einen ersten Überblick verschaffen. Die ASUE bietet ein Tool zur Berechnung des Wirtschaftlichkeit eines BHKW in Krankenhäusern an.
Weitere Informationen zur Energieeffizienz in Krankenhäusern
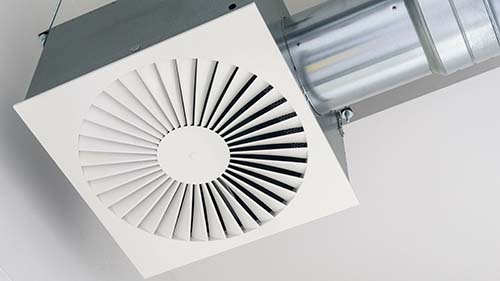
Alles über die effiziente Beheizung von Hallen mit Warmluftheizungen
Für Ihre allgemeine Kontaktanfrage füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus. Wir werden uns anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen. Ihre Anfrage wird selbstverständlich vertraulich behandelt.